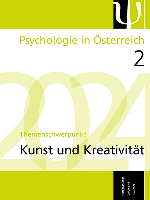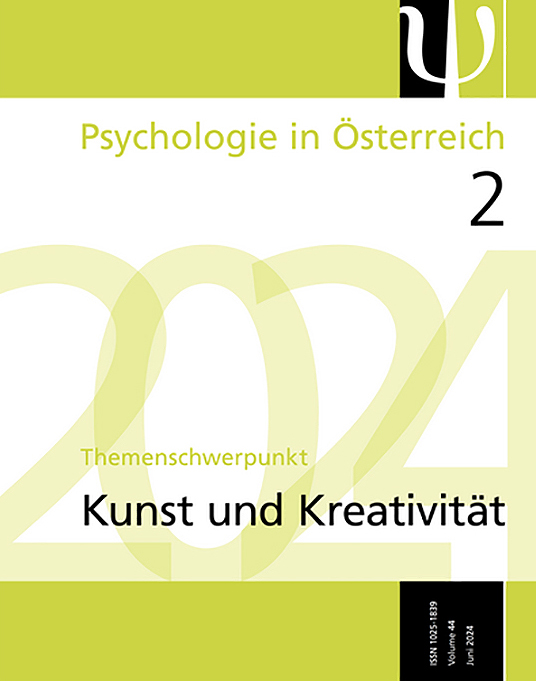
PIÖ: Sehr geehrter Herr Helnwein, ich würde unser Gespräch gerne mit etwas mehr oder weniger Aktuellem beginnen - mit dem Fastentuch, das Sie für den Stephansdom geschaffen haben. Soweit ich das verstanden habe war das nicht als einmalige Aktion gedacht sondern als Trilogie.
Helnwein: Richtig, das hier wäre der zweite Teil gewesen: die Auferstehung (Helnwein zeigt auf einen großformatigen Ausdruck einer Fotografie), konzipiert für ein Format von 5 mal 10 Meter.
Ich habe mich mit dieser Arbeit ganz bewusst an der christlichen Symbolik und Ikonografie und insbesondere an der Tradition katholischen Kirche orientiert.
Da ich mich mich mit Religionsgeschichte befasst habe, bin mit der Symbolik der verschiedenen religiösen Traditionen einigermassen vertraut.
Und obwohl sich meine Darstellung genau in dieser Tradition befindet, ist es zu geradezu hysterischen Reaktionen gekommen.
Bilder wurden immer potentiell als Gefahr betrachtet, ebenso wie das geschriebene Wort, daher kam es immer wieder zu Bilderstürmerei und Bücherverbrennungen.
Calvin hat massenhaft Gemälde und Skulpturen vernichten lassen, und Kritiker seiner Doktrin gemeinsam mit ihren Schriften auf den Scheiterhaufen verbrennen lassen. Das Verbot von Bildern, vor allem der Abbildung von Menschen, hat in den monotheistischen Religionen, wie im Judentum und im Islam, eine lange Geschichte,
Die katholische Kirche war da eigentlich immer eine Ausnahme. Vor allem in der Gegenreformation hat die Kirche eine wahre Bilderflut auf die Menschen losgelassen.
In der katholischen Ikonographie ist das zentrale Thema der künstlerischen Darstellung: Blut, Schmerz und Tod. Gott als leidender, gedemütigter, blutender, hilflos, sterbender Mensch.
Es ist das erste Mal, dass in einer Religion das Göttliche nicht nur mit Superiorität, Unverwundbarkeit und Allmacht assoziiert wird, sondern als vollkommene Identifikation mit der leidenden menschlichen Kreatur, als Beweis der grenzenlosen Empathie Gottes.
Wie man bei Grünewalds Isenheimer Altar, und vielen anderen Werken sehen kann, und in Hieronymus Boschs Visionen der Hölle wird die Unentrinnbarkeit des Schreckens durch Ästhetik transzendiert und bedeutet, so wie die Auferstehung, den Sieg über den Tod.
Aber nirgends drückt, sich die Freude über den Triumph des Lebens, nach dem Ende der Pest und dem Sieg über die Türken, so sehr aus wie in der gewaltigen, unverschämten Sinnesorgie der theatralischen Barockarchitektur mit all diesen, gen Himmel wirbelnden, ekstatischen Gestalten, und den in Verzückung erstarrten Märtyrern, den fetten, durcheinander purzelnden Engeln und den tanzenden Totengerippen, mit der vergoldeten Sanduhr in der knöchernen Hand, der heiligen Theresa in Ekstase und dem verklärt lächelnden Sebastian, dessen schöner, von Pfeilen durchbohrter Leib sich lustvoll windet, und der Orgasmus der aufbrausenden Orgel. Extase, Eros und Tod in einer gewaltigen Apotheose vereinigt.
PIÖ: Was war so schlimm an Ihrem Fastentuch, dass man sich so aufregen musste?
Helnwein: Ich habe sehr viel begeisterte Reaktionen bekommen, und die Mehrheit der Menschen hat diese Arbeit sehr gut aufgenommen. Es war eine kleine Minderheit von ultrakonservativen rechtsradikalen Querulanten, die einen Shitstorm entfacht haben, und die dargestellten Totenköpfe als satanistische Symbolik bezeichnet haben.
Über das Internet hat sich diese kleine Gruppe von hysterischen Bilderstürmern zusammen gefunden, und den Kardinal mit Protestriefen bombardiert der daraufhin in Panik geraten ist und das ganze Projekt einfach abgebrochen hat.
Dabei gehört der Hinabstieg Jesu Christi in das Reich des Todes zu den christlichen Glaubenswahrheiten, im katholischen Katechismus heisst es: ‘Hinabgestiegen in das Reich des Todes’. Der Totenkopf als ‘Memento Mori’ hat seit mehr als tausend Jahren einen festen Platz in der christlichen Ikonographie.
PIÖ: das ist Vanitas-Ikonografie...
Helnwein: Der Totenkopf als Symbol der Endlichkeit des irdischen Lebens, ‘Staub zu Staub, Asche zu Asche”, war die Ermahnung der Christen, das Seelenheil des ewigen Lebens danach zu bedenken.
In der Vergangenheit haben die Menschen die Symbolik dieser Bildsprache verstanden, und sie waren im Umgang auch mit drastischen Darstellungen relativ robust.
Durch den Einfluss der Massenmedien und vor allem des internets haben sich die Bedeutungen und Empfindlichkeiten im kollektiven Bewusstsein offensichtlich verschoben, es ist eine Art Opferkult entstanden, in dem jeder Bedeutung gewinnt, wenn er sich öffentlich durch irgendetwas in seinen Gefühlen verletzt fühlen kann.
PIÖ: Wie ist das für einen Künstler, wenn so etwas passiert; man hat eine Idee, man hat was vorbereitet, man denkt sich was, man hat ein Konzept – und dann passiert etwas, wo es dann heißt, man kann nach dem ersten Drittel nicht weiter machen.
Helnwein: Meine Bilder haben die Menschen nie kalt gelassen, sie haben immer emotionale Reaktionen ausgelöst, was aber ganz im Sinn meiner Arbeit ist, die ich immer als Dialog verstanden habe.
In letzter Zeit ist es aber, vor allem durch irgendwelche Fanatiker immer öfter zu Protesten und Attacken gekommen, die dann durch das Internet verbreitet werden, um und mit Hilfe eines Shitstorms Druck auf die Veranstalter auszuüben.
Im Falle des Stephansdomes war die schnelle Kapitulation des Domkapitells wirklich verblüffend und niveaulos, weil der Vertrag mit mir, ohne mich zu konsultieren, einseitig einfach abgebrochen wurde.
Blöd wenn man so viel Arbeit in ein Projekt investiert und keinerlei Honorar verlangt, aber der Dom hat jetzt vielleicht das grössere Problem, weil er ab nun die Fanatiker am Hals hat, die in Zukunft bestimmen werden, welche Kunst im Dom gezeigt werden darf und welche nicht.
Grundsätzlich ist es so, dass meine Arbeit seit den ersten Bildern eigentlich immer wieder zu emotionalen Reaktionen geführt hat, wobei das nicht geplant ist von mir, da ich ja nicht voraussehen kann, wie die Menschen reagieren werden.
Ich hab meine Bilder immer als Dialog mit den Betrachtern verstanden, den ich nun schon seit einem halben Jahrhundert führe,
Ich äußere mich mit visuellen Mitteln und dann entlasse ich das Werk in die Öffentlichkeit und ab da habe ich keine Kontrolle mehr über mein Bild, dann liegt sein Schicksal in den Händen des Publikums.
Marcel Duchamp sagte: “Der Künstler ist nur verantwortlich für 50% des Prozesses - der Betrachter für die anderen 50%”, und das kommt auch meinem Begriff von Kunst am nächsten.
Und dann gibt es halt die unterschiedlichsten Reaktionen, die allerdings manchmal erstaunlich sind. Ich lerne eine Menge dabei, denn ich nehme die Empfindungen und Gedanken der Menschen ernst.
Für mich sind die spontanen und emotionalen Reaktionen der Betrachter, ein wesentlicher Teil des Prozesses, auch wenn jemand aggressiv auf meine Werke reagiert, - mich interessiert immer warum jemand so reagiert und ich muss sagen dass ich eine Menge aus den Gesprächen mit den Menschen gelernt habe.
Grundsätzlich sind die Reaktionen zu 95 Prozent positiv. Ich staune immer, wie viele Leute sich an mich wenden und sich bei mir bedanken, und mir ihre ganz persönlichen und intimen Gedanken und Erlebnisse erzählen.
Immer wieder höre ich: “Ihre Bilder begleiten mich seit meiner Kindheit und sind für mich ein Teil meiner Erinnerung.”
Eine junge Frau, die eine Dissertation über meine Arbeit geschrieben hat sagte mir eines Tages:
“Ich erzähle Ihnen jetzt etwas, das ich noch niemanden gesagt habe.
Ich habe ihre Bilder das erste mal in einem Katalog gesehen, als ich 14 war, ich war ganz fasziniert und musste immer wieder hinschauen, und plötzlich habe ich zu zittern begonnen, und ich fand mich in einer art Schockzustand und begann zu weinen. Ich habe meine Überreaktion selbst nicht verstanden und ich musste immer wieder ihre Bilder betrachten, und langsam dämmerten meine lange vergessenen eigenen Bilder und Erinnerungen in mir hoch, und ich wusste wieder, dass ich als Kind missbraucht wurde. Ich habe mich weiter mit Ihren Bildern beschäftigt und das hat mir geholfen, mein Trauma zu überwinden.”
Wenn konservativ-kirchliche Kreise meinen Arbeiten pädophile Inhalte vorwerfen, muss man kein Psychoanalytiker sein, um zu sehen, dass dieser Ruf nach Zensur nur der hilflose Versuch ist, nicht an die eigenen Schweinereien erinnert zu werden, die man mit so viel Mühe zu unterdrücken versucht.
Meine Bilder sind hier wirklich nicht das Problem
Ö: Aber fließt das dann irgendwie in ihre Kunst ein was Sie von den Leuten erfahren?
Helnwein: ja, bis zu einem gewissen Grad – nicht direkt, aber indirekt auf jeden Fall. Ich höre den Menschen gerne zu, vor allem denen, die kunsthistorisch nicht vorinformiert sind, und natürlich auch den Kindern. Es sind die spontanen, emotionalen Reaktionen, die mich interessieren. So wie Kandinsky sagt, ‘das einzige was Kunst braucht ist der naive Betrachter’ .
Es ist verblüffend, wie unterschiedlich die Bilder von verschiedenen Menschen wahrgenommen werden. Jeder Betrachter nimmt seine eigene Version des Bildes wahr, für jeden hat es seine eigene ganz persönliche Bedeutung, je nach Persönlichkeit und Erfahrungshintergrund. Wenn mir dann jemand seine eigene Interpretation zu meinem Bild erzählt, trete ich manchmal zurück und betrachte mein eigenes Bild noch einmal mit neuen Augen, und dabei habe ich mehr über meine eigene Arbeit erfahren und gelernt, als durch die Analysen von Experten und Theoretikern.
PIÖ: das ist übrigens etwas, was ich gehört habe von Besuchern der letzten Albertina-Ausstellung: Sie seien auch ein bisschen unterwegs gewesen in ihrer eigenen Ausstellung und haben ein bisschen auf die Leute geschaut...
Helnwein: Die Herstellung der Bilder im Atelier ist ja ein sehr einsamer Prozess, erst nach oft jahrelanger Verzögerung, erreichen die Werke in einer Ausstellung die, für die sie bestimmt sind. Erst wenn jemand vor meinem Bild steht und es betrachtet, weiss ich dass es angekommen ist. Und erst dann ist meine Arbeit abgeschlossen, und dieser Augenblick interessiert mich.
Viele kommen dann ganz spontan auf mich zu, und teilen mir ihre Empfindungen oder Betrachtungen mit, oder sie stellen mir Fragen.
Ich mache auch Führungen für ganz unterschiedliche Gruppen, wenn ich darum gebeten werde, auch für Kinder.
Immer wieder erlebe ich, dass sich Erwachsene, vor allem Kuratoren und Journalisten, Sorgen machen, dass meine Bilder einen verstörenden Effekt auf Kinder haben könnte. Deshalb werden meine Museums-Ausstellungen in der Regel mit Warnhinweisen versehen, wie etwa: ‘Jugendliche unter 18 Jahren sollten die Ausstellung nur in Begleitung Erwachsener sehen”, oder so ähnlich. Wenn ich bedenke, womit Kinder heutzutage im Internet konfrontiert sind, scheint mir diese Besorgnis in Bezug auf meine Bilder etwas realitätsfremd.
Nach meiner Erfahrung können Kinder sehr gut mit meinen Arbeiten umgehen, sie verarbeiten Bilder ganz anders als Erwachsene, und haben einen viel spontaneren und unbefangeneren Zugang zu Bildern und Geschichten. Erwachsene sind da viel komplizierter, sie sind in der Regel viel befangener durch zu viel Erziehung, Indoktrinierung, Regeln und Wertesysteme.
Kinder können auch sehr gut auch mit schwierigen Themen umgehen.
PIÖ: Es ist vielleicht ein bisschen wie bei Märchen – die darf man ja nach Ansicht mancher Leute auch nicht mehr erzählen, weil sie so brutal sind...
Helnwein: Ich halte die Bevormundung der Woke-Bewegung, die uns durch Zensur, Unterdrückung von Informationen und Cancel Culture vor allen angeblich schädlichen EInflüssen schützen will, für eine völlige Entmündigung der Menschen. Es wäre das Ende der freien Rede. Nur durch einen offenen und freien Diskurs kann eine aufgeklärte, demokratische Gesellschaft entstehen.
Jeder muss das Recht haben sich frei zu äussern, das inkludiert auch das Recht etwas Blödes oder Falsche zu sagen. Wie kann ein Lern- und Reifeprozess entstehen, wenn jede Erfahrung und Konfrontation unterdrückt und verhindert wird, wenn man keine Fehler mehr machen darf, aus denen man lernen kann.
Und wer sind die Autoritäten, die bestimmen, was richtig und was falsch ist, was wir sagen, denken und empfinden dürfen, und was nicht?
Hat uns die Geschichte nicht gezeigt, dass die dieses Dank- und Verhaltensdiktat durch selbsternannte Eliten immer zu Katastrophen für die Menschen geführt hat?
PIÖ: Das wirkt sich auch auf den Universitäten aus... ich habe einmal einmal einen Kollegen eingeladen, der ein Kinderschutzzentrum gegründet hatte und er hat über Vernachlässigung und sexuellen Missbrauch geredet weil das halt sein Thema ist. Da war eine Kollegin darunter, die beim nächsten Mal gesagt hat naja, da hätte sich aber schon eine Triggerwarnung erwartet, weil da geht es ja um unangenehme Sachen... Nun ist Psychologie ja die Lehre vom Erleben und Verhalten des Menschen, und da muss man sich auf manche Dinge gefasst machen...
Helnwein: Es wird uns suggeriert, dass die neue Political Correctness und Zensur aus der linken Bewegung kommt, das stimmt aber nicht, sie kommt direkt aus der Calvinistisch-Puritanischen Tradition Amerikas.
Man merkt das auch daran, wie die Sprache reglementiert wird. Im Calvinistischen Protestantismus muss man sehr aufpassen, was man sagt. Jedes Wort ist wie eine Tretmine. Im Alltag sagen die Leute zwar dauernd „fuck“ dies und „fuck jenes, aber im amerikanischen Fernsehen und Radio wurden diese Worte immer schon durch Peep-Töne unkenntlich gemacht, und im Druck durch Sternchen ersetzt. Jeder weiß zwar, was gemeint ist, aber Fluchen ist für Puritaner eine schwere Sünde. Bilder sind böse, schmutzige Worte sind böse, und müssen daher um jeden Preis verhindert werden.
In Ländern mit katholischer Tradition darf geflucht, geschweinigelt und gesündigt werden, denn es gibt ja die Beichte, Reue und die Absolution, im puritanischen Protestantismus gibt es diese Möglichkeit nicht, daher der Zwang zur permanenten Unfehlbarkeit, die Last der Schuld kann man nur loswerden indem man die damit verbunden Worte eliminiert, und damit auch die Verbindung zur eigenen Schuld. Zum Beispiel die Verbrechen der Briten und Amerikaner an den Afrikanern, die sie versklavt hatten. Man streicht einfach das N-Wort aus der Sprache, und die eigene Gerechtigkeit ist wieder hergestellt.
Diese Calvinistische Political Correctness hat eine total Scheinheilige Gesellschaft geschaffen, mit einer selbstgefälligen kapitalistische Elite, die in Wahrheit ein einziges korruptes Gesindel ist.
PIÖ: Reagieren die Amerikaner anders auf ihre Bilder als Europäer?
Helnwein: Ja! In Amerika ist die Toleranz was Bilder und Kunst betrifft viel geringer als hier, die Sachen die man hier zeigen kann – so wie meine grossen Bilder am Ringturm z.B. der immerhin einer große Versicherungsgesellschaft gehört– das wäre in Amerika absolut undenkbar.
Anlässlich einer Ausstellung im Werner Berg Museum in Bleiburg war die ganze Stadt in eine einzige Installation verwandelt worden, an allen Hausfassaden hingen meine Bilder, über der Polizeistation prangte ein Kind mit einer Maschinenpistole, und die ganze Bevölkerung hat begeistert mitgemacht, all das wäre in Amerika absolut unmöglich.
Vor meiner Einzelausstellung im Fine Arts Museum in San Francisco, gab es
schwere Bedenken des Board of Directors und der Kuratoren, ob man dem Publikum solche Bilder zumuten kann.
Ich selbst hatte ganz andere Zweifel, ich empfand die Gesellschaft in Los Angeles als extrem oberflächlich, egozentrisch, geprägt von einer ‘cheap entertainment culture’ und überflutet von elektronischen ‘special effects’. Ich dachte, wer wird da noch vor einem gemalten Ölbild stehenbleiben und es betrachten. Vielleicht war meine Technik und Methode überholt und völlig anachronistisch? So waren jedenfalls meine Überlegungen.
Als die Ausstellung dann tatsächlich stattfand, war ich vollkommen verblüfft,
niemals haben Menschen so emotional auf meine Bilder reagiert wie in dieser Museumsausstellung. Menschen, die mich erkannten, umarmten mich spontan und bedankten sich, viele hatten Träne in den Augen. Eine Frau sagte zu mir: “You can’t imagine how important it is that you show your work right here and right now”.
Ein Museumswärter kam auf mich zu und sagte: “das hier ist einfach ein Job für mich, die Bilder, die hier ausgestellt werden, haben mich noch nie interessiert, aber bei Ihren Arbeiten ist das ganz anders, die Leute reagieren auch anders, sie sind aufgeregt und sie diskutieren, sie kommen sogar auf mich zu fragen mich, und wollen mit mir über die Bilder reden. So etwas habe ich noch nie erlebt”.
In diesem Moment habe ich erkannt, dass egal wie oberflächlich und dekadent eine Gesellschaft auch erscheinen mag, doch tief in jedem einzelnen Menschen, die Sehnsucht nach authentischer Kunst und Kommunikation vorhanden ist.
PIÖ...da liegt ein Bedürfnis darunter...
Helnwein: Ganz egal wie unterschiedlich verschiedene Gesellschaften geprägt und konditioniert sind, wie sehr das Verhalten der Masse reglementiert und kontrolliert wird, wenn immer man mit dem einzelnen individuellen Menschen selbst in Berührung kommt, wird man merken, dass sich alle Menschen in den Grundbedürfnissen sehr ähnlich sind, auch in ihren Sehnsüchten, Träumen, Bedürfnissen und Ängsten, und dass auch das Empfinden, was ethisch oder moralisch richtig oder falsch ist, grundsätzlich als universeller Code, in jedem Menschen tief verwurzelt ist.
PIÖ: Also geht es eigentlich darum die Menschen zu erreichen, nämlich persönlich wirklich zu erreichen?
Helnwein: Ja, man könnte sagen, das der eigentliche Sinn meiner Kunst ist.
Es gibt ja viele Theorien, Erklärungsversuche, Interpretationen und Analysen von Kunst, die ich auch alle sehr nett finde, aber sie werden nie den Kern der Kunst treffen, da Kunst eben nicht Wissenschaft ist und daher auch nie mit wissenschaftlichen Methoden ergründet werden kann. Was richtig ist: man kann einen differenzierteren Blick auf Kunst werfen, aber das eigentliche Kunsterlebnis findet nicht in der Ratio, nicht im analytischen Verstand statt,
Kunst kann man nur mit den Sinnen, dem Herzen oder der Seele, erfahren. Jede Kunst entsteht völlig intuitiv, und jede relevante Kunst kommt aus der “inneren Notwendigkeit” des Künstlers, wie Kandinsky sagt.
Der Künstler kann das was er geschaffen hat im Nachhinein rationalisieren oder ein System draus machen; das stimmt, aber das erklärt nie den ursprünglichen, ersten Impuls.
Mit Religion ist es ähnlich, der Versuch irgendwelche Glaubensinhalte wissenschaftlich widerlegen zu wollen ist absurd, man kann die Auswirkungen und irgendwelche Aspekte beschreiben und verschiedene Sichtweisen aufzeigen, aber die individuelle mystische Erfahrung kann weder erklärt noch entschlüsselt werden.
Ich erinnere mich an eine Begebenheit in Sankt Petersburg, als ich meine Retrospektive im Staatlichen Russischen Museum hatte. Ich besuchte eine orthodoxe Kirche mit diesen goldenen Zwiebeltürmen, und betrat einen dunklen, Weihrauch geschwängerten Raum, der nur von unzähligen flackernden Kerzen erhellt war, die von den vielen goldenen Ornamenten und Bilderrahmen reflektiert wurden, dann sah ich eine junge Frau, entrückt lächelnd, ganz nah vor einer Marien-Ikone knien, die Hände zum Gebet gefaltet, und ich sah die Tränen, die über ihr wunderschönes Gesicht rannen.
Es ist wie in den Märchen und den Wundern von Lourdes, es gibt Bereiche der Psyche, die man nur seelisch erfahren kann, wo unser rationales Denken nicht hinkommt.
Un das trifft auch für die Kunst zu.
PIÖ: Sie haben von der Führung in der Albertina erzählt mit Leuten die Künstler werden wollen... wie wird man denn Künstler? Oder ist man Künstler und muss dann nur schauen dass man es auch leben kann? Oder wie entsteht das?
Helnwein: Zum einen ist es sicher diese innere Notwendigkeit, zum andern muss man irgendwann beschliessen sich ganz der Kunst auszuliefern und man muss sich alle Fluchtwege und Möglichkeiten des Rückzugs verschliessen. Und dieser Beschluss ist wichtiger als jedes Talent. Es gibt viele die Talent zum Zeichnen , malen oder singen haben, die aber niemals Künstler werden, und es gibt andere, die völlig untalentiert erscheinen und bedeutende Künstler werden. Wichtig ist der Drang, die Hingabe, die Leidenschaft, die Obsession, die Hartäckigkeit, Radikalität, Kompromisslosigkeit und Ausschliesslichkeit..
PIÖ: ...sich ausdrücken zu wollen?
Helnwein: Ja, es ist dieser unbedingte Drang sich mit ästhetischen Mitteln mitteilen zu wollen, durch den man zum Künstler werden kann. Für mich ist Kunst auch eine Waffe, eine Möglichkeit, mich gegen die Zumutungen der Welt zu wehren, zurückzuschlagen.
Ich war schon als Kind sehr neugierig, ich wollte immer wissen, was wirklich ist, und ich stellte fest, dass mir die Erwachsenen die Antworten verweigerten oder dass sie mich anlogen, was ihnen wahrscheinlich gar nicht bewusst war, weil sie selbst immer angelogen wurden.
Irgendwann, ich glaube ich war etwa 10 Jahre alt las ich in der Zeitung einen Bericht über den Prozess gegen Franz Murer, den ’Schlächter von Wilna’, der eigenhändig Kinder und Frauen gefoltert, in ihrer Todesangst verhöhnt und eiskalt abgeschlachtet hat, und in einem Skandalprozess freigesprochen, und daraufhin im Triumphzug durch Graz getragen wurde. Dieser Moment war eine Zäsur in meinem Leben, da zerbrach mein Vertrauen in die Gesellschaft meiner Eltern und ihre Werte und Traditionen. Und von da an habe ich begonnen, geradezu obsessiv, mich mit Geschichte und Politik zu beschäftigen, ich habe alles gelesen, was ich zu diesem Thema in die Hände kriegen konnte. Ich habe einfach nicht verstanden, was jemanden motiviert, und wie man dabei Lust dabei empfinden kann, jemandem Schmerzen zuzufügen, der sich nicht wehren kann, und mir ist bewusst geworden, dass die Geschichte der Menschheit auch eine Geschichte der Gewalt ist.
Helnwein: Ja, es ist dieser unbedingte Drang sich mit ästhetischen Mitteln mitteilen zu wollen, durch den man zum Künstler werden kann. Für mich ist Kunst auch eine Waffe, eine Möglichkeit, mich gegen die Zumutungen der Welt zu wehren, zurückzuschlagen.
Ich war schon als Kind sehr neugierig, ich wollte immer wissen, was wirklich ist, und ich stellte fest, dass mir die Erwachsenen die Antworten verweigerten oder dass sie mich anlogen, was ihnen wahrscheinlich gar nicht bewusst war, weil sie selbst immer angelogen wurden.
Irgendwann, ich glaube ich war etwa 10 Jahre alt las ich in der Zeitung einen Bericht über den Prozess gegen Franz Murer, den ’Schlächter von Wilna’, der eigenhändig Kinder und Frauen gefoltert, in ihrer Todesangst verhöhnt und eiskalt abgeschlachtet hat, und in einem Skandalprozess freigesprochen, und daraufhin im Triumphzug durch Graz getragen wurde. Dieser Moment war eine Zäsur in meinem Leben, da zerbrach mein Vertrauen in die Gesellschaft meiner Eltern und ihre Werte und Traditionen. Und von da an habe ich begonnen, geradezu obsessiv, mich mit Geschichte und Politik zu beschäftigen, ich habe alles gelesen, was ich zu diesem Thema in die Hände kriegen konnte. Ich habe einfach nicht verstanden, was jemanden motiviert, und wie man dabei Lust dabei empfinden kann, jemandem Schmerzen zuzufügen, der sich nicht wehren kann, und mir ist bewusst geworden, dass die Geschichte der Menschheit auch eine Geschichte der Gewalt ist.
PIÖ: Das ist eine psychologische Frage...
Helnwein: Wenn man sich mit dieser Thematik intensiv auseinander setzt, stellt man fest, dass sich die Menschheit auf ethischem Gebiet seit den Anfängen nicht weiterentwickelt hat, Inquisitionen, Hexenverbrennungen, Folter, Genozide, Holocausts, Gewalt in jeder Form hat es zu allen Zeiten gegeben, an jedem Ort dieses Planeten, und sie findet auch gerade jetzt überall statt.
Helnwein: Wenn man sich mit dieser Thematik intensiv auseinander setzt, stellt man fest, dass sich die Menschheit auf ethischem Gebiet seit den Anfängen nicht weiterentwickelt hat, Inquisitionen, Hexenverbrennungen, Folter, Genozide, Holocausts, Gewalt in jeder Form hat es zu allen Zeiten gegeben, an jedem Ort dieses Planeten, und sie findet auch gerade jetzt überall statt.
PIÖ: In dem Artikel in der New York Times über Sie habe ich gelesen, dass Sie sich sehr für die Abgründe des Menschlichen interessieren: „Es gibt eine sehr dunkle Seite des Menschlichen und die ist so dunkel dass man sich eigentlich nicht wirklich damit konfrontieren kann“ werden Sie dort zitiert.
Helnwein: Nietzsche hat gesagt : ‘Wer zu lange in den Abgrund starrt wird zum Abgrund’.
Da ist was dran. Ich denke man sollte emotional eine gewisse Distanz bewahren, wenn man sich mit dem Abgründigen der menschlichen Existenz auseinandersetzt, aber man muss sich dem Entsetzlichen stellen und das Nicht-Konfrontierbare konfrontieren, Wegschauen und Verdrängen garantiert nur den Fortbestand des barbarischen Zustandes.
Zu allen Zeiten sind die Menschen bestimmten Informationen oder Narrativen ausgesetzt,
die ihnen die Welt erklären. Man könnte das auch als Propaganda bezeichnen. Man wächst auf und bekommt ein bestimmtes Weltbild verpasst, in dem alles gut zusammenpasst, und in dem alle Fragen schon beantwortet sind. Die meisten Menschen lieben diese Glaubensysteme, denn sie haben etwas beruhigendes und sind sind selbstevident, da alle anderen in der Gruppe genau das gleiche denken und sich gegenseitig ständig die Richtigkeit und Gültigkeit dieser Realität versichern. Man weiss was gut und was schlecht ist, was falsch und was richtig, alles ist entweder schwarz oder weiss, es gibt keine Grauzonen. Das gilt für alle religiösen, weltanschaulichen, gesellschaftlichen und politischen Systeme. Wichtig für die Aufrechterhaltung dieser Illusion ist aber, dass niemand wagt dieses Kontinuum in Frage zu stellen, das wird immer als die ultimative Bedrohung und als Verrat betrachtet, und mit dem Scheiterhaufen, KZ oder Gulag bestraft. Im Gruppendenken muss um jeden Preis an der offiziellen Realität festgehalten werden. Jede andere Sicht der Dinge, die das genormte Gruppendenken in Frage stellen könnte, muss um jeden Preis verhindert werden. Ein wesentliches Element dieser Gruppendynamik ist die Urangst, dass jeder Zweifel, das ganze Gebilde zum Einsturz bringen könnte und damit die Existenz jedes einzelnen vernichten würde. Es gibt da keinen Platz für Kompromisse - die eigene Gruppe hat immer absolut recht, die anderen haben immer absolut unrecht,
Das erklärt die ständigen, nicht enden wollenden Kriege.
Helnwein: Nietzsche hat gesagt : ‘Wer zu lange in den Abgrund starrt wird zum Abgrund’.
Da ist was dran. Ich denke man sollte emotional eine gewisse Distanz bewahren, wenn man sich mit dem Abgründigen der menschlichen Existenz auseinandersetzt, aber man muss sich dem Entsetzlichen stellen und das Nicht-Konfrontierbare konfrontieren, Wegschauen und Verdrängen garantiert nur den Fortbestand des barbarischen Zustandes.
Zu allen Zeiten sind die Menschen bestimmten Informationen oder Narrativen ausgesetzt,
die ihnen die Welt erklären. Man könnte das auch als Propaganda bezeichnen. Man wächst auf und bekommt ein bestimmtes Weltbild verpasst, in dem alles gut zusammenpasst, und in dem alle Fragen schon beantwortet sind. Die meisten Menschen lieben diese Glaubensysteme, denn sie haben etwas beruhigendes und sind sind selbstevident, da alle anderen in der Gruppe genau das gleiche denken und sich gegenseitig ständig die Richtigkeit und Gültigkeit dieser Realität versichern. Man weiss was gut und was schlecht ist, was falsch und was richtig, alles ist entweder schwarz oder weiss, es gibt keine Grauzonen. Das gilt für alle religiösen, weltanschaulichen, gesellschaftlichen und politischen Systeme. Wichtig für die Aufrechterhaltung dieser Illusion ist aber, dass niemand wagt dieses Kontinuum in Frage zu stellen, das wird immer als die ultimative Bedrohung und als Verrat betrachtet, und mit dem Scheiterhaufen, KZ oder Gulag bestraft. Im Gruppendenken muss um jeden Preis an der offiziellen Realität festgehalten werden. Jede andere Sicht der Dinge, die das genormte Gruppendenken in Frage stellen könnte, muss um jeden Preis verhindert werden. Ein wesentliches Element dieser Gruppendynamik ist die Urangst, dass jeder Zweifel, das ganze Gebilde zum Einsturz bringen könnte und damit die Existenz jedes einzelnen vernichten würde. Es gibt da keinen Platz für Kompromisse - die eigene Gruppe hat immer absolut recht, die anderen haben immer absolut unrecht,
Das erklärt die ständigen, nicht enden wollenden Kriege.
PIÖ: Ich wollte noch fragen: wie ist das mit den Kindern? wieso so viele Kinder in den Bildern?
Helnwein: Als Kind habe ich gedacht, ich sei etwas besonderes, ich war überzeugt, dass Kindsein im Allgemeinen etwas ganz besonderes sei, und ich war entsetzt, dass ich nicht ernst genommen wurde, dass ich dressiert werden sollte wie ein Pudel und und immer wieder mal eine übergebraten bekam, wenn ich nicht parierte. Ich war empört und entsetzt über meine Hilflosigkeit. Damals habe ich mir geschworen: eines Tages werde ich selbst Kinder haben, und die dürfen dann alles!
Das sollte meine Rache an dem System sein, und ich habe mich daran gehalten, ich habe 4 Kinder und 4 Enkelkinder, die vollkommen frei aufgewachsen sind.
Ich habe nie die Rolle des Vorgesetzten gespielt, ich sah mich eher als Verbündeter, als Komplize, der ihre Freiheit garantierte. Ich habe ihnen sogar frei gestellt ob sie zur Schule gehen wollten oder nicht, ich bot ihnen an jede gewünschte Entschuldigung zu schreiben. Ich selbst hatte meine Schule gehasst, seltsamerweise gingen meine Kinder aber gerne zur Schule, oder genauer gesagt, an viele verschiedene Schulen, da wir an verschiedenen Orten gelebt hatten.
Ich habe viel von meinen Kindern gelernt, weil ich ihnen zugehört habe, und ich habe mit ihnen gemeinsam Geschichten erfunden.
Meine Kinder sind alle Künstler geworden, meine Tochter ist Schriftstellerin und Malerin, ein Sohn ist Komponist, ein anderer ist Fotograf und mein Assistent.
Kinder und Frauen sind häufig Gewalt ausgesetzt, weil sie physisch schwächer sind, und die Gewalt ist vorwiegend männlich. Ich wollte immer auf der Seite der Kinder sein, und die Auseinandersetzung dieser Thematik ist das Thema meiner Kunst geworden.
Helnwein: Als Kind habe ich gedacht, ich sei etwas besonderes, ich war überzeugt, dass Kindsein im Allgemeinen etwas ganz besonderes sei, und ich war entsetzt, dass ich nicht ernst genommen wurde, dass ich dressiert werden sollte wie ein Pudel und und immer wieder mal eine übergebraten bekam, wenn ich nicht parierte. Ich war empört und entsetzt über meine Hilflosigkeit. Damals habe ich mir geschworen: eines Tages werde ich selbst Kinder haben, und die dürfen dann alles!
Das sollte meine Rache an dem System sein, und ich habe mich daran gehalten, ich habe 4 Kinder und 4 Enkelkinder, die vollkommen frei aufgewachsen sind.
Ich habe nie die Rolle des Vorgesetzten gespielt, ich sah mich eher als Verbündeter, als Komplize, der ihre Freiheit garantierte. Ich habe ihnen sogar frei gestellt ob sie zur Schule gehen wollten oder nicht, ich bot ihnen an jede gewünschte Entschuldigung zu schreiben. Ich selbst hatte meine Schule gehasst, seltsamerweise gingen meine Kinder aber gerne zur Schule, oder genauer gesagt, an viele verschiedene Schulen, da wir an verschiedenen Orten gelebt hatten.
Ich habe viel von meinen Kindern gelernt, weil ich ihnen zugehört habe, und ich habe mit ihnen gemeinsam Geschichten erfunden.
Meine Kinder sind alle Künstler geworden, meine Tochter ist Schriftstellerin und Malerin, ein Sohn ist Komponist, ein anderer ist Fotograf und mein Assistent.
Kinder und Frauen sind häufig Gewalt ausgesetzt, weil sie physisch schwächer sind, und die Gewalt ist vorwiegend männlich. Ich wollte immer auf der Seite der Kinder sein, und die Auseinandersetzung dieser Thematik ist das Thema meiner Kunst geworden.
PIÖ: Von Anfang an?
Helnwein: Ja von Anfang an, das war der Grund warum ich Künstler geworden bin.
PIÖ: Was wollten Sie als Kind werden?
Helnwein: Als Kind wollte ich Revolutionsführer werden. Ich war ein wirklich schlechter Schüler, und statt im Unterricht aufzupassen, habe ich in meinen Tagträumen eine Revolution inszeniert, das ganze korrupte System gestürzt hat. Später wollte ich Kinderarzt werden.
Mit 18 habe ich eines Tages gewusst, es gibt nur eine einzige Möglichkeit in diesem System für mich - die Kunst, als der letzte relative Freiraum in dieser Gesellschaft.
Als Kind dachte ich Künstler sind Leute mit Bärten und Baskenmützen, die den ganzen Tag vor einer Staffelei stehen und abstrakte Bilder malen, etwas faderes konnte ich mir gar nicht vorstellen.
PIÖ: Sie sind ja noch dazu ein sehr langsamer und sorgfältiger Maler…
Helnwein: Ja leider, aber nicht weil ich so gerne so hyperrealistisch male. So seltsam es klingen mag ich betrachte mich eigentlich als Konzeptkünstler, und für das was ich ausdrücken, und für die Wirkung, die ich erzielen will, brauche ich diese Präzision und über-realistische Technik, leider.
Ich habe aber von 1970 an auch Aktionen und Performances gemacht und fotografisch dokumentiert. Ich habe immer mit den unterschiedlichsten Medien gearbeitet: Fotografie und Zeichnungen, Installationen im öffentlichen Raum, Bühnenbilder und Kostüme für die Oper und das Theater, und derzeit arbeite ich an einer Serie von Skulpturen. Aber das Grundthema meiner Arbeiten ist immer das gleiche geblieben: Das Kind.
Dieses Thema war der Grund warum ich zu malen begonnen habe, meine ersten, kleinen Aquarelle von verwundeten, bandagierten Kindern.
Wobei ich die Darstellung des Kindes auch als Metapher für die menschliche Existenz an sich verstehe, es geht mir vor allem darum, die Verletzlichkeit des Menschen sichtbar zu machen.
Bei Kindern ist alles viel offensichtlicher und klarer, Erwachsene sind komplizierter, und die Individualität, Spontanität und Kreativität ist oft unter Schichten von anerzogenen Verhaltensmustern begraben.
Diese ursprüngliche, zumindest potentielle Reinheit, Offenheit und Spontanität, die Fähigkeit zur grenzenlosen Imagination und Kreativität hat mich immer fasziniert.
Picasso hat einmal gesagt: ‘Jedes Kind ist ein Künstler, aber es ist schwer Künstler zu bleiben, wenn man erwachsen wird”
Jeder Mensch ist einmal ein Kind, nicht jeder wird erwachsen, nicht jeder wird alt, aber
jeder beginnt als Kind.
Diese Phase ist so kostbar, aber gerade da ist der Mensch so zerbrechlich und verwundbar und völlig auf den Schutz, den Respekt und die Empathie der Erwachsenen angewiesen.
In der Regel sorgen die Erziehungssysteme der Erwachsenen, dass viele dieser Qualitäten systematisch zerstört werden.
Diese Problematik wollte ich in meinen Arbeiten sichtbar machen, und ich sehe dass meinen Bilder die Menschen emotional berühren.
Klaus Schröder, der Direktor der Albertina hat gesagt: ‘Wir haben alle bedeutenden zeitgenössischen Künstler ausgestellt, von Kiefer bis Richter, aber bei der Helnwein Retrospektive haben wir gesehen, wie Menschen vor den Bildern standen und zu Tränen gerührt waren, ich konnte es kaum glauben”
Helnwein: Ja leider, aber nicht weil ich so gerne so hyperrealistisch male. So seltsam es klingen mag ich betrachte mich eigentlich als Konzeptkünstler, und für das was ich ausdrücken, und für die Wirkung, die ich erzielen will, brauche ich diese Präzision und über-realistische Technik, leider.
Ich habe aber von 1970 an auch Aktionen und Performances gemacht und fotografisch dokumentiert. Ich habe immer mit den unterschiedlichsten Medien gearbeitet: Fotografie und Zeichnungen, Installationen im öffentlichen Raum, Bühnenbilder und Kostüme für die Oper und das Theater, und derzeit arbeite ich an einer Serie von Skulpturen. Aber das Grundthema meiner Arbeiten ist immer das gleiche geblieben: Das Kind.
Dieses Thema war der Grund warum ich zu malen begonnen habe, meine ersten, kleinen Aquarelle von verwundeten, bandagierten Kindern.
Wobei ich die Darstellung des Kindes auch als Metapher für die menschliche Existenz an sich verstehe, es geht mir vor allem darum, die Verletzlichkeit des Menschen sichtbar zu machen.
Bei Kindern ist alles viel offensichtlicher und klarer, Erwachsene sind komplizierter, und die Individualität, Spontanität und Kreativität ist oft unter Schichten von anerzogenen Verhaltensmustern begraben.
Diese ursprüngliche, zumindest potentielle Reinheit, Offenheit und Spontanität, die Fähigkeit zur grenzenlosen Imagination und Kreativität hat mich immer fasziniert.
Picasso hat einmal gesagt: ‘Jedes Kind ist ein Künstler, aber es ist schwer Künstler zu bleiben, wenn man erwachsen wird”
Jeder Mensch ist einmal ein Kind, nicht jeder wird erwachsen, nicht jeder wird alt, aber
jeder beginnt als Kind.
Diese Phase ist so kostbar, aber gerade da ist der Mensch so zerbrechlich und verwundbar und völlig auf den Schutz, den Respekt und die Empathie der Erwachsenen angewiesen.
In der Regel sorgen die Erziehungssysteme der Erwachsenen, dass viele dieser Qualitäten systematisch zerstört werden.
Diese Problematik wollte ich in meinen Arbeiten sichtbar machen, und ich sehe dass meinen Bilder die Menschen emotional berühren.
Klaus Schröder, der Direktor der Albertina hat gesagt: ‘Wir haben alle bedeutenden zeitgenössischen Künstler ausgestellt, von Kiefer bis Richter, aber bei der Helnwein Retrospektive haben wir gesehen, wie Menschen vor den Bildern standen und zu Tränen gerührt waren, ich konnte es kaum glauben”
PIÖ: Wie ist es für eine Künstler, eine derartige Erfahrung zu machen?
Helnwein: Ich bin selbst erstaunt über die Reaktionen.
Es ist schwer für mich meine eigenen Bilde einzuschätzen, dazu fehlt mir die Distanz.
Aber ich habe schon sehr früh erkannt, dass Bilder eine potentielle Macht haben, dass sie Bereiche im Unterbewusstsein berühren können, an die man sonst nicht so leicht herankommt.
Immer wieder sprechen mich Menschen an und wollen mit mir über meine Bilder reden, aber in der Regel erzählen sie dann über mehr über sich selbst, oft über ganz persönliche und intime Dinge.
In den Ausstellungen sind die Reaktionen immer positiv, meine letzte Ausstellung in der Albertina wurde von 300,000 Menschen gesehen. Noch niemals hat ein lebender Künstler in der Geschichte dieses Museums so viele Besucher gehabt.
Meine Installationen im öffentlichen Raum erreichen aber auch ganz andere Schichten der Bevölkerung, und da kommt immer wieder zu Protesten und Attacken von Extremisten, die mir alles mögliche unterstellen vom Aufruf zur Gewalt, nazionalsozialistischer Wiederbetätigung bis zur Pädophilie.
Helnwein: Ich bin selbst erstaunt über die Reaktionen.
Es ist schwer für mich meine eigenen Bilde einzuschätzen, dazu fehlt mir die Distanz.
Aber ich habe schon sehr früh erkannt, dass Bilder eine potentielle Macht haben, dass sie Bereiche im Unterbewusstsein berühren können, an die man sonst nicht so leicht herankommt.
Immer wieder sprechen mich Menschen an und wollen mit mir über meine Bilder reden, aber in der Regel erzählen sie dann über mehr über sich selbst, oft über ganz persönliche und intime Dinge.
In den Ausstellungen sind die Reaktionen immer positiv, meine letzte Ausstellung in der Albertina wurde von 300,000 Menschen gesehen. Noch niemals hat ein lebender Künstler in der Geschichte dieses Museums so viele Besucher gehabt.
Meine Installationen im öffentlichen Raum erreichen aber auch ganz andere Schichten der Bevölkerung, und da kommt immer wieder zu Protesten und Attacken von Extremisten, die mir alles mögliche unterstellen vom Aufruf zur Gewalt, nazionalsozialistischer Wiederbetätigung bis zur Pädophilie.
PIÖ: In dem Artikel in der New York Times habe ich noch ein Zitat gefunden; es geht da um Aktionismus, Anzeigen, Polizeieinsätze usw bei Ausstellungen und dort werden Sie zitiert mit: „Jeder hat mich gehasst, aber ich mochte es.“
Helnwein: Na ja, da ist schon ein ordentliches Stück journalistischer Freiheit.
Dass mich jeder gehasst hat stimmt natürlich nicht, aber es gab immer wieder auch heftige Reaktionen, die mich aber immer sehr interessiert haben.
Für mich waren die spontanen und emotionalen Reaktionen immer ein wesentlicher Teil des künstlerischen Prozesses und ich habe viel gelernt aus den Gesprächen mit den Menschen, die auf meine Arbeiten reagiert haben.
Anfang der 70er Jahre kam ein Journalist der ‘Pressen in eine Ausstellung und griff mich zornig an: “Endlich treffe ich Sie, Als ich Ihre Bilder gesehen habe, dachte ich, so etwas kann sich nur ein Geisteskranker ausdenken!”
und: “Ich kann nicht mehr schlafen, weil ich dieses blöde Bild nicht aus dem Kopf kriege”
Er wies auf das Aquarell mit dem Titel “Peinlich”, ein puppenhaftes Kind mit einem vernarbten Gesicht und einem Comic Heft im bandagierten Händchen.
“Warum malen Sie so etwas?”
Da ich nicht wusste, was ich darauf antworten sollte, sagte ich: “Darf ich Sie zuerst etwas fragen?” “Ok” Waren Sie Soldat im Krieg?” “Ja”, “Haben Sie Leute sterben gesehen? “ Natürlich, es war ja Krieg”, “haben Sie selbst getötet?” “Vielleicht”, antwortete er.
“Könnten Sie trotzdem schlafen?” “Natürlich, das war halt der Krieg”.
“Als Journalist haben doch sicher Forensische Fotos von Verbrechen gesehen, auch solche, die man gar nicht veröffentlichen kann, weil sie drastisch sind” “Ja”, “Können Sie trotzdem schlafen?” “Natürlich, das ist ja mein Beruf”
Dann sagte ich:”Es ist doch interessant, dass der reale Tod und das Töten, das wirkliche Leid der Menschen, die tatsächlichen Katastrophen für Sie kein grosses Problem darstellen, dass Sie aber durch eine Stück Papier mit ein paar milligram Farbe und ein bisschen Gummi Arabicum darauf, durch dieses kleine Bildchen, mit einer frei erfundenen Darstellung, so erschüttert sind, dass Sie nicht mehr schlafen können.”
Da wurde mir bewusst, dass es nicht meine Bilder sind , die den Betrachtern Probleme bereiten, sondern die Bilder in ihren Köpfen, die sie lieber unsichtbar gelassen hätten.
PIÖ: Ein wunderbares Schlußwort.... Herr Helnwein, ich danke Ihnen herzlich für das interessante und angenehme Gespräch.
Helnwein: Na ja, da ist schon ein ordentliches Stück journalistischer Freiheit.
Dass mich jeder gehasst hat stimmt natürlich nicht, aber es gab immer wieder auch heftige Reaktionen, die mich aber immer sehr interessiert haben.
Für mich waren die spontanen und emotionalen Reaktionen immer ein wesentlicher Teil des künstlerischen Prozesses und ich habe viel gelernt aus den Gesprächen mit den Menschen, die auf meine Arbeiten reagiert haben.
Anfang der 70er Jahre kam ein Journalist der ‘Pressen in eine Ausstellung und griff mich zornig an: “Endlich treffe ich Sie, Als ich Ihre Bilder gesehen habe, dachte ich, so etwas kann sich nur ein Geisteskranker ausdenken!”
und: “Ich kann nicht mehr schlafen, weil ich dieses blöde Bild nicht aus dem Kopf kriege”
Er wies auf das Aquarell mit dem Titel “Peinlich”, ein puppenhaftes Kind mit einem vernarbten Gesicht und einem Comic Heft im bandagierten Händchen.
“Warum malen Sie so etwas?”
Da ich nicht wusste, was ich darauf antworten sollte, sagte ich: “Darf ich Sie zuerst etwas fragen?” “Ok” Waren Sie Soldat im Krieg?” “Ja”, “Haben Sie Leute sterben gesehen? “ Natürlich, es war ja Krieg”, “haben Sie selbst getötet?” “Vielleicht”, antwortete er.
“Könnten Sie trotzdem schlafen?” “Natürlich, das war halt der Krieg”.
“Als Journalist haben doch sicher Forensische Fotos von Verbrechen gesehen, auch solche, die man gar nicht veröffentlichen kann, weil sie drastisch sind” “Ja”, “Können Sie trotzdem schlafen?” “Natürlich, das ist ja mein Beruf”
Dann sagte ich:”Es ist doch interessant, dass der reale Tod und das Töten, das wirkliche Leid der Menschen, die tatsächlichen Katastrophen für Sie kein grosses Problem darstellen, dass Sie aber durch eine Stück Papier mit ein paar milligram Farbe und ein bisschen Gummi Arabicum darauf, durch dieses kleine Bildchen, mit einer frei erfundenen Darstellung, so erschüttert sind, dass Sie nicht mehr schlafen können.”
Da wurde mir bewusst, dass es nicht meine Bilder sind , die den Betrachtern Probleme bereiten, sondern die Bilder in ihren Köpfen, die sie lieber unsichtbar gelassen hätten.
PIÖ: Ein wunderbares Schlußwort.... Herr Helnwein, ich danke Ihnen herzlich für das interessante und angenehme Gespräch.